Insulinpumpen-Therapie
Der Grundbedarf: Viele kleine Insulindosen
Bei einem Nicht-Diabetiker gibt die Bauchspeicheldrüse in ganz kurzen Abständen kleine Mengen von Insulin an den Blutkreislauf ab, um Glukose aus dem Blut in die Zellen transportieren und daraus Energie gewinnen zu können.
Mit der intensivierten konventionellen Insulintherapie (ICT) fühlen sich Menschen mit Typ-1-Diabetes im Alltag oftmals eingeschränkt. Um die Grundversorgung des Körpers mit Insulin (Basalinsulin) decken zu können, muss morgens und abends, manchmal noch zusätzlich mittags, langwirksames Insulin injiziert werden. Zusätzlich wird kurz wirksames Insulin zu den Mahlzeiten benötigt (Bolusinsulin).
Dieses Basis-Bolus-Prinzip liegt grundsätzlich auch der Insulinpumpen-Therapie zugrunde. Aber: Statt mehrmals am Tag mit dem Pen Insulin zu spritzen, tragen Sie eine Insulinpumpe, über die der Körper kontinuierlich mit dem Insulin-Grundbedarf versorgt wird. Den Bolus geben Sie einfach per Knopfdruck ab. Durch die kontinuierliche Versorgung mit Insulin kann sich Ihre Stoffwechsellage entscheidend verbessern – verbunden mit höherer Flexibilität und Lebensqualität für Sie.
Bis zu 480 Mal am Tag Insulin spritzen? Eine unmögliche Vorstellung. Genau dies leistet eine Insulinpumpe. Sie gibt in kurzen Abständen und automatisch rund um die Uhr kleinste Mengen kurzwirksamen Insulins an den Körper ab. Bis zu 480 Mal. Dabei folgt sie einem Schema (Basalrate genannt), das auf Sie persönlich zugeschnitten ist. Hier kommen wieder die insulinproduzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse als Vorbild ins Spiel, an denen sich die Insulinpumpen-Therapie vom Prinzip her orientiert. Die Insulinversorgung kann so optimal an den im Tagesverlauf wechselnden Bedarf angepasst werden.
Die Abgabe des Mahlzeitenbolus erfolgt nicht automatisch: Die Höhe des Bolus muss zu jeder Mahlzeit neu berechnet werden, wie bei der intensivierten Insulintherapie. Trotzdem erleichtert die Insulinpumpe vieles: Im Unterschied zur ICT wird das Bolusinsulin nicht gespritzt, sondern einfach per Knopfdruck aus der Insulinpumpe abgerufen. Das Gleiche gilt für einen Korrekturbolus.
24 Stunden mit Insulin versorgt
Eine Insulinpumpe wird Sie 24 Stunden am Tag begleiten. Wie ist es, Tag und Nacht dieses „Ding“ zu tragen? Beim Sport? Nachts? Beim Sex? Das kann Ihnen keine Broschüre vermitteln. Am besten unterhalten Sie sich darüber mit Pumpenträgern. Vielleicht können Sie eine Insulinpumpe in der Diabetesberatung einen Tag „trocken“ ausprobieren. Die Erfahrung zeigt: Wer sich einmal für eine Insulinpumpe entschieden hat, will sie selten wieder ablegen. Die Vorteile der Therapie sind überzeugend.
Zwei Prinzipien stehen hier zur Wahl:
Eine konventionelle Insulinpumpe wird zum Beispiel am Gürtel oder in der Hosentasche getragen. Sie gibt Insulin über einen Schlauch (Katheter) an den Körper ab. Am Schlauchende befindet sich eine Kanüle, die in das subkutane Fettgewebe am Bauch, Oberschenkel oder Gesäß eingeführt wird.
Eine Insulin-Patch-Pumpe („Pflaster-Pumpe“) kommt ohne Schlauch aus. Sie besteht aus einem kleinen Gerät, das direkt auf die Haut geklebt wird. Es beinhaltet Pumpe, Insulinreservoir und Kanüle in einem. Die Steuerung der Insulinabgabe erfolgt über ein externes Gerät, ähnlich einem Mobiltelefon.
Insulinpumpen-Therapie für Kinder
Insulinpumpen haben sich besonders bei der Therapie von Kindern und Jugendlichen etabliert, um die Stoffwechseleinstellung zu verbessern sowie Eltern und Kinder im angespannten Diabetesalltag zu entlasten. Für Kinder mit Diabetes ist eine Insulinpumpen-Therapie eine gute Alternative zur Insulintherapie mit mehreren Injektionen täglich. Sie bietet den Kindern mehr Sicherheit.
Neues Lebensgefühl mit Pumpe
Bei einer Insulinpumpe stehen verschiedene Bolusvarianten zur Wahl. Je nach Zusammensetzung der Mahlzeit können Eltern den passenden Bolus wählen, so dass eine verzögerte Insulinabgabe bei fettreichen Mahlzeiten, die außerdem viele durch das Fett gebundene Kohlenhydrate enthalten, wie Pizza oder Nudeln, bei Geburtstagsfeiern kein Problem mehr ist. Durch die einfache Menüführung lernen Kinder schnell die Bedienung einer Pumpe. Sollen die Kinder aus Sicherheitsgründen die Insulinpumpe nicht selbst bedienen, kann mithilfe einer eingebauten Tastensperre, welche in den meisten Insulinpumpen bereits integriert ist, eine unbeabsichtigte Bedienung verhindert werden. Durch ihre offene Art, fällt Kindern der Umgang mit der Pumpe meist sehr leicht. Sie wachsen direkt mit einer Pumpe auf und empfinden diese nicht als Störfaktor.
Große Vorteile bieten Insulinpumpen auch für Frauen mit Kinderwunsch bzw. bei einer bestehenden Schwangerschaft, denn mit Unterstützung der Insulinpumpe können Frauen den stark schwankenden Insulinbedarf besser ausgleichen.
Die Insulinpumpen-Therapie zur Behandlung des Typ-1-Diabetes muss durch den Arzt per Gutachten begründet werden. Dazu gehört auch eine umfassende Dokumentation der Diabetesdaten durch den Patienten. Weitere Informationen finden Sie beim Genehmigungsverfahren.
-
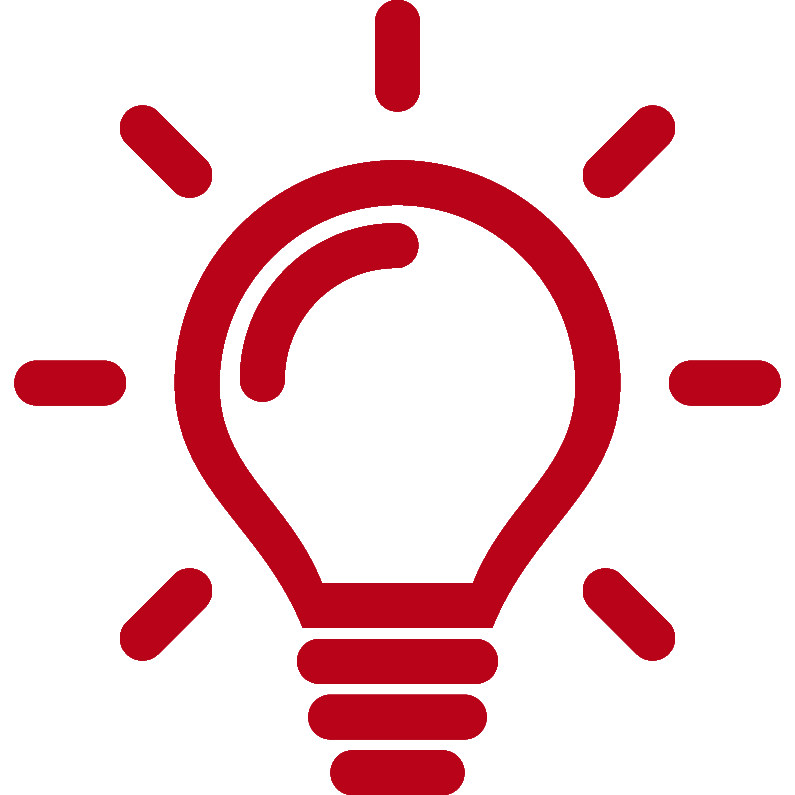
Bitte beachten Sie: Eine Insulinpumpe kann vieles erleichtern, übernimmt aber nicht das „Denken“ im Rahmen der Diabetestherapie. Ihre aktive Mitarbeit ist weiterhin unbedingt erforderlich. So sind zum Beispiel regelmäßige Blutzucker-Selbstkontrollen und Insulinanpassungen sowie eine enge Zusammenarbeit mit dem Diabetesteam eine Grundvoraussetzung für den Therapieerfolg.
